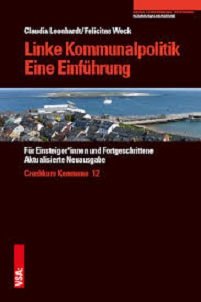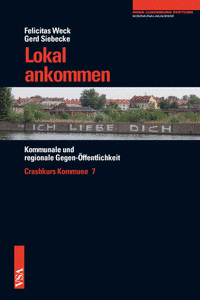Zur Vorbereitung der Kongress-Workshops des bundesweiten Kommunalpolitischen Kongresses am 27. und 28. März in Essen erarbeiten wir gerade Thesenpapiere. Einer der Workshops beschäftigt sich mit Spekulationen in der Kommune, ein Thema, mit dem ich mich schon länger befasse und ein übles Spiel mit fiesem Ausgang. Einige Kämmerer haben immer noch nichts draus gelernt, daher ist ein solcher Workshop notwendig. Mitte der neunziger Jahre nahmen die ersten Finanzchefs der Kommunen Abschied von ihrer konservativen Kassenführung und jonglierten plötzlich mit Produkten des globalen Geldmarktes. Ohne den Rat darüber zu informieren stürzten sich die Kämmerer in Geschäfte, die sie überforderten und deren Konsequenzen sie nicht einschätzen konnten.
Jahrelang ging alles gut, doch der internationale Bankenzusammenbruch Ende 2008 hat viele Kommunen voll erwischt.
Beispiel Zins-Swaps: Dabei geht es um eine Wette mit der Bank auf die zukünftige Entwicklung von Zinsen. Im Gegensatz zur Pferdewette oder zum Lotto ist es hier möglich auch mehr zu verlieren als den Einsatz auf diese Wette. Einstiegspartnerin war in vielen Fällen die Deutsche Bank. Der Städte- und Gemeindebund warnte die Kommunen, sich auf derlei Finanzprodukte einzulassen, sie entsprächen nicht der Auffassung von verantwortungsvollem Umgang mit Steuergeldern. Doch das schnelle Geld lockte. Wie groß der Schaden insgesamt ist, den die riskanten Geldmanöver in den Städten und Gemeinden anrichten werden, kann derzeit niemand absehen. Klar ist aber, dass die Kosten letztlich auf Steuer- und Gebührenzahler umgelegt werden.
In NRW beispielsweise haben 40 bis 60 Kommunen schon jetzt einen dreistelligen Millionen-Betrag an Steuergeldern verloren, hier nur einige wenige Beispiele: Hagen 50 Millionen €, Remscheid 13 Millionen €; Neuss 10 Millionen €; Solingen 1,5 Millionen €; Mülheim 6 Millionen €. Rund 700 Kommunen und kommunale Unternehmen spielten bundesweit mit.
Beispiel Einlagen bei krisengeschüttelten Finanzinstituten: Kommunen hatten kurzfristige Haushaltsmittel bei Banken angelegt. Sofern es nicht um Sichteinlagen geht, die von den Einlagensicherungsfonds abgedeckt sind, droht bei Bankinsolvenz Totalverlust.
Lehman-Brothers-Bank: Etlichen Kommunen haben Geld in Zertifikate der Lehman-Bank gesteckt. Diese Papiere sind nun wertlos, dadurch sind einzelnen Kommunen zweistellige Millionenverluste entstanden, beispielsweise: Frankfurt a.M., 95 Millionen €, Köln 90 Millionen €, Freiburg 47 Millionen €, Kreis Euskirchen 35 Millionen €, Karlsruhe 10 Millionen €;
Georgsmarienhütte: Der Stadtkämmerer von Georgsmarienhütte in Niedersachsen hat bis zu zehn Millionen der Rücklagen und Steuer-Mehreinnahmen bei der Frankfurter Lehman-Brothers-Tochter angelegt, die Stadt Esslingen 14 Millionen €.
Hypo-Real-Estate: Die Notwendigkeit der Rettung der HRE wurde wesentlich damit begründet, dass neben Ländern und Berufsgenossenschaften auch Kommunen hohe Einlagen bei der HRE gehabt haben sollen. Genaue Zahlen rückt die Bundesregierung aber bisher nicht raus.
Beispiel Zinsderivate: Derivatgeschäfte gehören in vielen Kommunen zum kommunalen Alltag des „Schuldenmanagements“. Sofern sie nur zur Zinsabsicherung und nur im Rahmen des abgeschlossenen Kreditgeschäftes genutzt werden, mag dieses Instrument vielleicht beherrschbar sein, sobald aber Geschäfte mit Derivaten – unabhängig vom Kreditgeschäft - zum Erwirtschaften separater Gewinne dienen, sind diese Geschäfte der Spekulation zuzuordnen. Viele Länder haben inzwischen Verordnungen erlassen, die deutlich machen, dass für die Kommunen ein Spekulationsverbot besteht. Die Grauzone ist weit, aber immer dann, wenn ein Finanzderivat ohne Definition oder ohne Begrenzung auf einen maximalen Verlust abgeschlossen oder gehalten wird, ist von einer Spekulation auszugehen.
Pforzheim beispielsweise ist dabei in das Visier der Mannheimer Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen geraten. Die 100.000-Einwohner-Stadt in Baden-Württemberg hatte seit 2002 riskante Finanzgeschäfte, sogenannte Zinsderivate, abgeschlossen. Daraus drohen nun Verluste in den Jahren 2014 bis 2017 von bis zu 77,5 Millionen Euro.
Beispiel Cross-Boarder-Leasing: Ab Mitte der 90er Jahre verkauften mehr als 150 Städte und Gemeinden ihre Infrastruktur an amerikanische Investoren und mieteten sie wieder zurück. Dieses Verfahren - Cross-Boarder-Leasing - ermöglichte den Investoren in den USA hohe Steuervorteile und wurde dort 2004 verboten. Köln verscherbelte sein Abwassernetz, Gelsenkirchen zahlreiche Schulen. Die Messe AG der Stadt Hannover verscherbelte ihre Messehallen und sitzt jetzt auf 250 Millionen Euro Schulden, Berlin versilberte seine Stadtbahnen. Hinter oft mehr als 1000 Seiten geheimer Vertragsklauseln – ausschließlich in Englisch - verstecken sich juristische Formulierungen nach US-amerikanischem Recht. Deren Sinn blieb den KommunalpolitikerInnen und vermutlich auch den agierenden Verwaltungskräften verborgen. Ein bekanntes Beispiel sind die Planungen zur Neckarbrücke in Stuttgart, die über einen Eingang in die verkaufte Kanalisation verliefen. Die Pläne mussten verändert werden, weil sich der Investor daran störte: Kosten rund 20 Millionen Euro.
In der Finanz- und Wirtschaftskrise sind die beteiligten Banken und Versicherungen ins Trudeln geraten. Als fragwürdig galten solche Deals unter KritikerInnen schon länger, jetzt sind sie richtig teuer geworden. Denn beteiligte Versicherungskonzerne und Banken büßten im Zuge der Finanzkrise ihre Vertrauenswürdigkeit ein. In den Verträgen zum Cross-Border-Leasing ist geregelt, dass in einem solchen Fall Ersatz zur Sicherung beschafft werden muss. Die notwendige Umverteilung der Sicherungen des Ruhrverbandes beispielsweise hat Kosten in Höhe von 4,5 Millionen Euro verursacht.
Diese Beispiele zeigen deutlich: Ehrenamtliche KommunalpolitikerInnen können solche Geschäfte nicht ohne Hilfe durchschauen. Es ist aber ihre Aufgabe, die Verwaltung zu kontrollieren und ihre Zustimmung erst dann zu erteilen, wenn sie davon überzeugt sind, dass derartige Geschäfte zum Vorteil der BürgerInnen und zum Erhalt der Daseinsvorsorge der Kommune sind. Und das geht nur, wenn sie die Unterlagen auch einsehen dürfen, lesen und verstehen können.
Der erste Schluss daraus muss also sein: Nur dann, wenn Finanzgeschäfte transparent darstellbar sind, können die zuständigen PolitikerInnen beurteilen, ob ihre Zustimmung angemessen ist. Ist ein Geschäft nicht transparent darstellbar, muss die Zustimmung verweigert werden.
Meine persönliche Einschätzung dazu: Immer dann, wenn es ums „große Geld“ geht, ist gesundes Misstrauen angebracht. Immer wieder fallen die Stadtmütter und –väter und oft auch die Verwaltungsführung auf Versprechungen von Beraterfirmen rein. Vielleicht deshalb so oft, weil sie ihrem eigenen gesunden Menschenverstand nicht trauen, weil sie Angst haben, als Miesmacher und Neinsager dargestellt zu werden. „Schöne“ Texte mit vielen Fremdwörtern vernebeln den Verstand und viele KommunalpolitikerInnen trauen dann ihrer eigenen Urteilsfähigkeit nicht mehr.